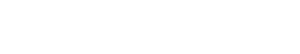Coaching ist heute in aller Munde. Besonders amerikanisches Coaching ist verbreitet – doch was genau darunter verstanden wird, ist sehr unterschiedlich. Schon in den 90er-Jahren schrieb mein Bruder – heute Geschäftsführer von Fischer Consulting – seine Diplomarbeit über Coaching. Wir waren damals mit unseren Angeboten sehr früh am Markt. Viele Menschen kannten den Begriff kaum, oft mussten wir erklären, dass Coaching nicht Therapie ist, sondern eine klare Begleitung auf Augenhöhe.
Damals wurde Coaching fast nur im sozialen Bereich genutzt. Ich habe aber sehr früh gesehen, wie wertvoll Coaching auch im Berufsalltag ist – gerade für Führungskräfte und Teams. Über die Jahre habe ich zusammen mit Fischer Consulting intensiv mit Geschäftsführern und Führungskräften gearbeitet. Genau dort zeigt sich besonders, wie unterschiedlich Coaching verstanden und praktiziert wird – und warum mein Ansatz sich so deutlich vom amerikanischen Modell unterscheidet.
Für mich gehört dazu auch Spiritualität – nicht im religiösen Sinn, sondern als innere Haltung: klar, respektvoll, offen und wertschätzend.
👉 über 100 Tipps wie Du Spiritualität im Berufsalltag leben kannst
Blinde Flecken von Führungskräften
Ein Beispiel aus meiner Praxis:
Eine Führungskraft erklärte mir im Coaching gleich zu Beginn, wer schuld an den Problemen im Unternehmen sei. Durch gemeinsame Reflexion stellte sich heraus: Er selbst nahm seine Führungsaufgabe nicht richtig wahr. Er hatte „Lieblinge“, andere Mitarbeitende überging er – dabei ist er Chef von allen. Zum Glück war er bereit, auch sich selbst coachen zu lassen. Erst dadurch kam Bewegung in den gesamten Unternehmensbereich.
Genau hier zeigt sich für mich der Unterschied: Während amerikanisches Coaching oft nur Symptome adressiert, geht es mir um echte Selbstreflexion.“
👉 Artikel über Führungserfahrungen aus meiner Blogparade
Amerikanisches Coaching – und warum ich es anders mache
Mein Ansatz ist ein anderer. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt – mit seinen Fähigkeiten, Grenzen, Gefühlen und Werten.
Wenn jemand ins Coaching kommt, geht es nicht darum, fremde Erwartungen zu erfüllen. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden:
- Was ist mein Ziel?
- Passt es zu meinem Wertesystem und zu meinem Umfeld?
- Ist es umsetzbar – für mich persönlich und für das Unternehmen?
Manchmal sind Ziele unklar. Dann gehört Zielklarheit mit zu dem, was wir erarbeiten. Dabei achte ich sehr auf Umsetzbarkeit – passend zur Person und passend zum Unternehmen.
Auch im Unternehmenskontext arbeite ich so:
- Der Chef benennt, was er sich wünscht oder wo er ein Problem sieht.
- Ich frage nach: Was kann er selbst tun, um dieses Ziel leichter zu erreichen?
- Dann beziehe ich die Mitarbeitenden ein. Wollen sie das überhaupt? Oder sehen sie andere Dinge als wichtiger an?
- Erst, wenn die Zieldifferenzen offen liegen, entsteht Klarheit.
Wichtig ist für mich: Nicht nur die Mitarbeitenden werden gecoacht, sondern auch die Führungskraft. Oft zeigt sich, dass sie selbst Teil des Problems ist – manchmal unbewusst, aus blinden Flecken heraus. Wenn sie bereit ist, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, kommt Bewegung ins ganze System.
Warum ich nicht alles mitmache – Beispiele aus meiner Praxis
Meine Haltung zeigt sich besonders in konkreten Coaching-Situationen. Oft wurde von mir erwartet, Dinge zu übernehmen, die nicht meine Aufgabe sind – und die mit echtem Coaching nichts zu tun haben.
Bank-Fall
Eine Vorgesetzte rief mich an und wollte, dass ich einem Mitarbeiter sage, er spreche „zu umgangssprachlich“ für die Bank. Sie sagte das nur mir – nicht ihm. Ich ging damals davon aus, dass er Bescheid wusste. Tat er aber nicht. Für mich war das nicht machbar: Ich hatte keine Beispiele, keine klare Grundlage, nur eine Fremderwartung. Also arbeitete ich mit ihm an den Themen, die für ihn relevant waren.
Daimler-Fall
Eine Führungskraft beauftragte mich sinngemäß: „Bitte waschen Sie dem Mitarbeiter den Kopf – und bereiten Sie ihn am besten gleich auf die Kündigung vor.“ Nein, danke. Das ist nicht meine Rolle. Kündigungen sind Aufgabe der Führung, nicht des Coaches. Meine Aufgabe ist es nicht, jemanden stillschweigend für den Rauswurf weichzukochen. Auch nicht ihn auf seine Verfehlungen aufmerksam zu machen, die ich nur vom Hörensagen kenne, und die nur hinter vorgehaltener Hand erzählt wurden.
Pseudo-Coaching
Wir hatten einen Auftrag für eine Führungskraft, arbeiteten intensiv und waren mitten im Prozess. Die nächsten Termine waren vereinbart. Plötzlich wurde die Person ihrer Position enthoben – und unser Coaching beendet. Sogar der Coach, der sich sprachlich für die Person eingesetzt hatte, wurde gleich mit entlassen. Für mich ein Paradebeispiel, wie Coaching missbraucht wird: als Machtinstrument, nicht als ehrlicher Entwicklungsprozess.
Landwirt-Fall
Ein Unternehmer kam zu mir ins Rhetorik-Seminar. Eigentlich war es der Wunsch seiner Frau, dass er „besser“ spricht. Er sprach im Dialekt, sehr direkt, mit klaren Beispielen – so, wie er als Landwirt und Unternehmer eben geprägt war. Mein Fazit: Er war völlig richtig so. Wir haben nur an Struktur und Verständlichkeit gearbeitet. Er ging gestärkt nach Hause, in seinem So-Sein. Und sogar den Besuch des Ministerpräsidenten auf seinem Hof konnten wir gemeinsam so vorbereiten, dass er klar und überzeugend auftrat – ohne sich zu verbiegen. Seine Frau hätte ihn wohl gerne eloquenter und nicht so kantig.
Zentrale Fragen meines Coaching-Verständnisses
Für mich stellt sich immer wieder die Frage: Wie sehr darf ein Arbeitgeber auf eine Person einwirken?
- Was ist mit den Gefühlen und Werten des Einzelnen?
- Wo endet der Einfluss des Unternehmens – und wo beginnt die Eigenverantwortung der Person?
Ich bin überzeugt: Es ist respektvoller, sich mit dem Mitarbeiter über die Schwierigkeiten auszutauschen und dann gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die für beide tragbar ist. Und wenn sich der Weg hier trennt. Das finde ich immer noch besser, als jemanden zum Coach zu zwingen.
Coaching im Change Management
Gerade im Change Management zeigt sich für mich besonders deutlich, warum amerikanisches Coaching problematisch ist: Ziele werden von oben vorgegeben, und die Mitarbeitenden sollen einfach nur auf Linie gebracht werden – ohne ihre eigene Sicht einzubeziehen.
Mein Ansatz sieht anders aus:
- Die Geschäftsleitung benennt, was sie erreichen will und wie sie den Bereich platzieren möchte.
- Wichtig ist dabei auch, dass sie uns die Hintergründe und Absichten erklärt. Nur so können wir ein Ziel im Kontext verstehen – und manchmal einen eleganteren Weg dorthin finden.
- Natürlich gibt es Fälle, in denen sich die Geschäftsleitung bedeckt halten muss. Aber auch dafür lässt sich eine Sprache finden, die die Situation klar macht, z. B.: „Es gibt interne Gründe, auf die ich hier nicht eingehen kann. Bitte nehmen Sie das als Fakt.“
- Die Mitarbeitenden geben ihre Sicht dazu: Passt das Ziel? Ist es realistisch? Wollen sie das überhaupt?
Durch diese Offenheit entsteht ein klarer und fairer Austausch. Führungskräfte und Mitarbeitende sehen sich gegenseitig in ihrer Verantwortung.
Und selbst wenn die Wege sich am Ende trennen, bleibt es menschlich in Ordnung. Denn Coaching ist nicht dazu da, Widerstand zu brechen – sondern Klarheit zu schaffen.
Fazit
Coaching ist nicht dazu da, Menschen „passend“ zu machen oder sie auf Ziele zu trimmen, die gar nicht ihre eigenen sind. Coaching ist für mich ein Prozess der Selbstklärung und Verständigung – zwischen Führungskraft, Mitarbeitenden und Unternehmen.
In meiner Praxis mache ich es deshalb oft so, dass der Chef vor dem Coaching mit dem Mitarbeitenden spricht – oder dieses Gespräch sogar in meiner Anwesenheit stattfindet. So ist von Anfang an klar, worum es geht, und der Mitarbeitende hat die Chance, seine eigenen Emotionen und Sichtweisen einzubringen. Diese Offenheit schafft Vertrauen und gibt allen Beteiligten eine gemeinsame Basis.
Mein Ansatz unterscheidet sich deshalb deutlich vom amerikanischen Modell:
- Keine fremdbestimmten Ziele.
- Keine heimlichen Aufträge.
- Sondern Klarheit, Respekt und Verantwortung – für alle Beteiligten.
Coaching bedeutet für mich, einen ehrlichen Raum zu schaffen, in dem Menschen sagen können, was für sie wirklich zählt – und wo auch Führungskräfte lernen, ihren eigenen Anteil zu sehen. Nur so entstehen Lösungen, die tragfähig, fair und wirksam sind.
Für mich ist das auch Spiritualität im Berufsalltag: klar, respektvoll, offen und wertschätzend – eine Haltung, die Entwicklung möglich macht.
👉 über 100 Impulse wie Spiritualität im Job gelebt werden kann. Einfach, geerdet, praxisnah.
Für Sie als Führungskraft bedeutet das: mehr Klarheit im eigenen Handeln, weniger Reibungsverluste mit Mitarbeitenden und eine Führung, die von Respekt getragen wird – statt von Druck.
📌 Was ich mit „amerikanischem Coaching“ meine
Es gibt keine offizielle Definition. Ich meine damit die in der Praxis oft erlebte Form von Coaching, die:
- stark zielorientiert ist,
- bei der der Chef oder das Unternehmen das Ziel vorgibt,
- in der der Coachee es einfach erreichen soll, egal ob es passt,
- und die den Fokus fast ausschließlich auf Leistung, Anpassung und Optimierung legt.
👉 Mein Ansatz dagegen: Selbstklärung, Werte, gemeinsame Zielüberprüfung und echter Dialog – für Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen gleichermaßen.
Andrea Sam, Kommunikationsberaterin und Coach – für gelingende Gespräche, klare Führung und persönliche Entwicklung.
Viele meiner Beispiele stammen aus Aufträgen, die ich gemeinsam mit meinem Bruder bei Fischer Consulting begleitet habe. Dort arbeiten wir mit Geschäftsführern und Führungsteams an Klarheit, Change Management und wirksamer Kommunikation – immer mit dem Blick auf Menschen, Strukturen und Märkte.